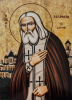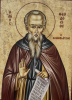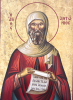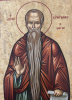Hirtenbrief Seiner Allheiligkeit zum Gebetstag für die Bewahrung der Schöpfung 2024
Protokoll-Nr. 481
+ Bartholomaios
durch Gottes Erbarmen Erzbischof von Konstantinopel, dem Neuen Rom,
und Ökumenischer Patriarch dem ganzen Volk der Kirche
Gnade und Friede von dem Schöpfer der ganzen Schöpfung,
unserem Herrn, Gott und Erlöser Jesus Christus
* * *
Verehrte Brüder im Bischofsamt, im Herrn geliebte Kinder,
Dreißig Jahre sind vergangen, seit die heilige Synode des Ökumenischen Patriarchats den 1. September, das Fest der Indiktion und des Beginns des Kirchenjahres, als Tag des Gebetes für den Schutz der natürlichen Umwelt bestimmt hat. Diese gesegnete Initiative hat ein breites Echo gefunden und reichlich Frucht getragen. Die vielfältigen ökologischen Aktivitäten der Heiligen Großen Kirche Christi konzentrieren sich heute auf das Phänomen des Klimawandels bzw. der Klimakrise, das inzwischen zu einem „Notstand planetarischen Ausmaßes“ geworden ist.
Wir schätzen den Beitrag der ökologischen Bewegungen, die internationalen Vereinbarungen zum Schutz der Umwelt, die Auseinandersetzung der Wissenschaftler mit dem Thema, den Wert der ökologischen Erziehung, die ökologische Sensibilität und die Mobilisierung zahlloser Personen, insbesondere von Vertretern der jungen Generation. Dennoch bestehen wir darauf, dass es einer wirklichen „kopernikanischen Wende“ bedarf, eines grundlegenden weltweiten Mentalitätswechsels, einer substantiellen Revision des Verhältnisses des Menschen zur Natur. Sonst werden wir weiterhin nur die katastrophalen Folgen der ökologischen Krise behandeln, während die Wurzeln des Problems unangetastet und virulent bleiben.
Die Umweltkrise ist nur eine Facette der umfassenden Krise der modernen Zivilisation. In diesem Sinn kann das Problem nicht auf der Basis der Prinzipien dieser Zivilisation gelöst werden, d. h. auf der Grundlage der Logik, die eben diese Zivilisation hervorgebracht hat. Wir haben schon oft und immer wieder unsere Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass die Kirchen und die Religionen einen bedeutenden Beitrag zu dem für die Zukunft der Menschheit und des Planeten entscheidenden geistlichen und die Werte betreffenden Wandel leisten können. Der genuine religiöse Glaube beseitigt die Überheblichkeit und den Titanismus des Menschen. Er ist ein Schutzwall gegen seine Mutation zum „gottgewordenen Menschen“, der Maße, Grenzen und Werte aufhebt; der sich selbst zum „Maß aller Dinge“ ernennt; der den Mitmenschen und die Natur für die Erfüllung seiner unersättlichen Bedürfnisse und seiner willkürlichen Ziele instrumentalisiert.
Die Erfahrung von Jahrhunderten lehrt, dass die Menschheit ohne einen „archimedischen“ Punkt geistlicher und die Werte betreffender Natur den Gefahren eines nihilistischen „Humanismus“ nicht entrinnen kann. Das ist das Vermächtnis des klassischen Geistes, wie er von Platon durch das Prinzip, nach welchem „der Gott für uns das Maß aller Dinge sein dürfte“ (Die Gesetze 716 C) zum Ausdruck gebracht wurde. Das Konzept des Menschen und seiner Verantwortung innerhalb seiner Beziehung zu Gott ist in der Lehre von der Erschaffung des Menschen nach „Gottes Bild und Gleichnis“ wie auch in der von der Annahme der menschlichen Natur durch das um des Heiles des Menschen und der Erneuerung der ganzen Schöpfung willen Fleisch gewordene vorewige Wort Gottes enthalten. Der christliche Glaube erkennt den höchsten Wert ebenso im Menschen wie in der Schöpfung. In diesem Sinn sind der Respekt vor der Heiligkeit der menschlichen Person und der Schutz der Unversehrtheit der „sehr guten“ Schöpfung untrennbar miteinander verbunden. Der Glaube an den Gott der Weisheit und der Liebe inspiriert und stärkt die schöpferischen Kräfte des Menschen. Er verleiht ihm Kraft angesichts der Herausforderungen und der Schwierigkeiten; das auch dann, wenn deren Überwindung nach menschlichen Maßstäben unerreichbar zu sein scheint.
Wir haben gekämpft und wir setzen uns weiter ein für die innerorthodoxe und innerchristliche Zusammenarbeit zum Schutz des Menschen und der Schöpfung und für die Einbeziehung dieser Thematik in den interreligiösen Dialog und die gemeinsamen Aktionen der Religionen. Wir betonen besonders, dass die gegenwärtige ökologische Krise in erster Linie und am meisten die ärmsten Bewohner der Erde trifft. In dem Dokument des Ökumenischen Patriarchats, das den Titel „Für das Leben der Welt – Soziallehre der Orthodoxen Kirche“ trägt, unterstreichen wir ausdrücklich diesen Aspekt und die notwendige Sorge der Kirche angesichts der Folgen des Klimawandels:
„Wir müssen verstehen, dass der Dienst am Nächsten und die Bewahrung der natürlichen Umwelt eng und untrennbar miteinander verbunden sind. Es besteht eine enge und unauflösliche Verbindung zwischen unserer Sorge für die Schöpfung und unserem Dienst am Leib Christi sowie zwischen den wirtschaftlichen Bedingungen der Armen und den ökologischen Bedingungen des Planeten. Nach Aussagen der Wissenschaftler werden diejenigen, die durch die gegenwärtige ökologische Krise am meisten geschädigt sind, auch weiterhin diejenigen sein, die am wenigsten haben. Die Frage des Klimawandels ist also auch eine Frage des sozialen Wohlergehens und der sozialen Gerechtigkeit.“ (§ 76)
Schließlich wünschen wir Euch, ehrwürdige Brüder und geliebte Kinder, dass das neue Kirchenjahr von göttlichen Segnungen erfüllt und fruchtbar sei, und rufen auf Euch - auf die Fürsprache der allheiligen Gottesgebärerin der Pammakaristos-Ikone - die Leben schenkende Gnade und das unermessliche Erbarmen des Schöpfers aller, des Gottes der Wunder, herab.
1. September 2024
+ Patriarch Bartholomaios von Konstantinopel
Euer aller inständiger Fürbitter