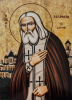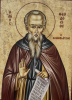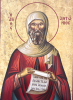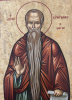Ankündigung bezüglich des Corona-Virus (11. März 2020)
Aus aktuellem Anlass bezüglich der von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus gibt die Metropolis von Austria bekannt, dass selbstverständlich alle von der Regierung erlassenen Maßnahmen übernommen und umgesetzt werden. Alle Gläubigen werden aufgefordert, sämtliche von der Bundesregierung erlassenen hygienischen Maßnahmen, sowohl im privaten Leben als auch in der Kirche und bei den Gottesdiensten einzuhalten, um sich selbst und auch ihre Brüder und Schwestern bestmöglich zu schützen.